Don’t Smoke - Ratgeber für Raucher, Nichtraucher und Passivraucher
Alles zum Risiko für Raucher und Passivraucher lesen Sie in der Broschüre "Ratgeber für Raucher, Nichtraucher und Passivraucher".
Infobroschüre herunterladen!
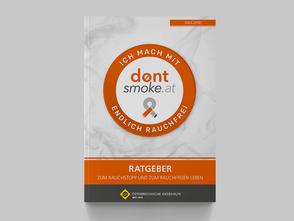

Man unterscheidet auf Basis des Erscheinungsbildes (Histologie) zwei Gruppen von Lungenkrebs. Diese Unterteilung ist aus medizinischer Sicht wichtig, weil die Therapie danach ausgerichtet wird.
Risikofaktor Nr. 1 für die Entstehung von Lungenkrebs ist das Rauchen. Aber auch bestimmte genetische Veranlagungen können eine Rolle spielen.
Das nicht-kleinzellige Lungenkarzinom (NSCLC) macht ca. 85 % der Krebserkrankungen der Lunge aus. Er wird noch einmal unterteilt, und zwar in:
Das kleinzellige Lungenkarzinom (SCLC) macht ca. 10 - 15 % der Krebserkrankungen der Lunge aus. Es ist dadurch charakterisiert, dass es sich rasch über den Blutweg und die Lymphbahnen ausbreitet.
Die Diagnose erfolgt mittels Anamnese, körperlichen Untersuchung, Blutbild sowie verschiedener bildgebender Verfahren wie Lungenröntgen, Computer-Tomographie (CT). Auch die Bronchoskopie, eine Spiegelung der Bronchien ist von Bedeutung. Über eine Lungenfunktionsprüfung wird weiters die Leistung der Atemwege und der Lunge erfasst. Zudem werden Gewebeproben entnommen und untersucht. So kann die Art des Tumors – nicht kleinzelliges Lungenkarzinom oder kleinzelliges Lungenkarzinom – bestimmt werden. Anschließend werden einige weitere Untersuchungen durchgeführt, die die Grundlage für die Therapieentscheidung darstellen. Diese molekulargenetischen Untersuchungen bestimmen das molekulargenetische Profil des Tumors. Dieses ist die Grundlage für eine individuell angepasste, maßgeschneiderte und damit zielgerichtete Therapie.
Wichtiger Hinweis: Molekulargenetische Untersuchungen werden nur in spezialisierten Einrichtungen durch erfahrene Patholog:innen durchgeführt.
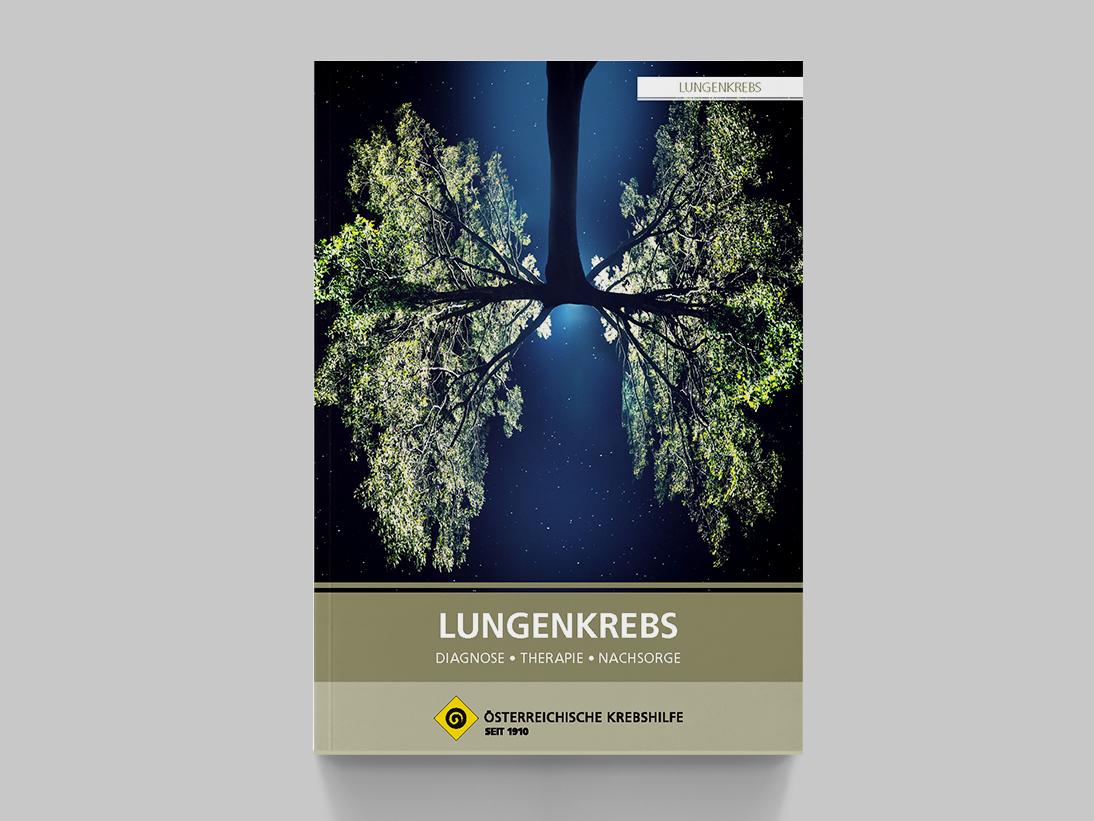
Ausführliche Informationen zu Diagnose und Therapie von Lungenkrebs erhalten Sie in der Krebshilfe-Broschüre „Lungenkrebs“.